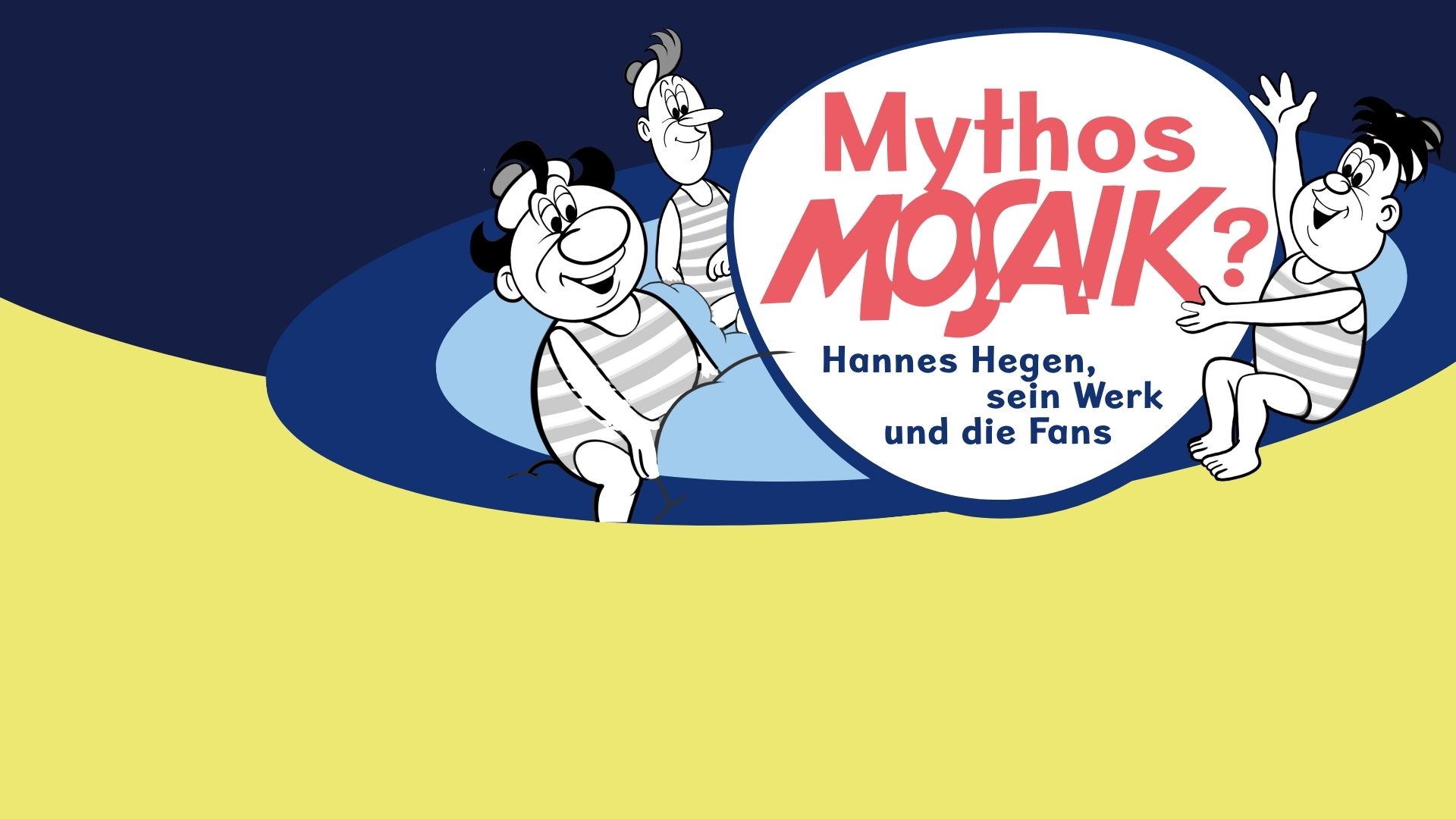


Eintritt frei
Der Eintritt zum Museum und allen Ausstellungen ist kostenlos.
Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag: 10–18 Uhr
Zu den Öffnungszeiten an Feiertagen
Besucherinformation
Aktuelles
Museumsmagazin
Neue Dauerausstellung in Bonn
Erfahren Sie im aktuellen Museumsmagazin mehr über die neue Dauerausstellung im Haus der Geschichte in Bonn!
Neues Angebot im Museum
ElternZEITgeschichte
Wir bieten Führungen für Eltern mit Babys an!
Kommende Veranstaltungen
Vortrag Saal
AlgorithMIX#DDR Geschichte in Social Media: erforscht und gespielt
Eintritt frei
Projektvorstellung mit Spielrunde
Mit Dr. Alexander Leistner und Anja Neubert (Universität Leipzig)
In Kooperation mit dem Historischen Seminar (Professur für Geschichtsdidaktik) und dem Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig
Eintritt frei
Wie steuern Algorithmen unser Bild von Geschichte? Welche Bezüge zur DDR finden sich in Social Media? Welche Themen dominieren den Feed und die Kommentare? Ein Team aus Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und Studierenden der Universität Leipzig hat im Forschungs- und Vermittlungsprojekt AlgorithMIX#DDR Deutungsmuster auf TikTok untersucht und ein Lernspiel entwickelt, das für die Logiken der Geschichtsvermittlung in Social Media sensibilisiert.
Im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig stellt das Team das Projekt vor und präsentiert die Ergebnisse der Studie. Nach einem Einblick, welche DDR-Bezüge auf TikTok zu finden sind, gibt es Gelegenheit, das Lernspiel selbst zu testen. Abschließend soll über die Bedeutung von Algorithmen zwischen historisch-politischer Bildung und digitaler Kompetenz diskutiert werden.
Workshop Wechselausstellung, 3.OG
Vom Garten in die Tasse: Kräuter- und Früchtetees aus eigener Ernte
Eintritt frei
Workshop im Ideengarten
Mit Scarlett Frantziok und Hannah Stöckle (Peißnitzhaus Halle)
Begleitprogramm zur Ausstellung „Übern Zaun – Gärten und Menschen“
Eintritt frei
Ob bei Krankheit oder Kälte – Tee trinken hilft und wärmt besonders in der kalten Jahreszeit. Dabei muss nicht unbedingt auf Mischungen aus industrieller Herstellung zurückgegriffen werden. Der eigene Garten bietet eine große Vielfalt an Kräutern und Früchten, die in heißem Wasser ihren Geschmack entfalten und wohltuende Wirkungen haben. Unter fachkundiger Anleitung können Gäste sich bei diesem Workshop mit dem Potenzial verschiedener Pflanzen auseinandersetzen und Tees verkosten.
Im Ideengarten der Wechselausstellung „Übern Zaun – Gärten und Menschen“ zeigen Scarlett Frantziok und Hannah Stöckle vom Umweltbildungszentrum Peißnitzhaus Halle, welche heimischen Kräuter und Früchte ganz einfach für Tee verwendet werden können und wie sie sich zu passenden Mischungen zusammensetzen lassen. Im Workshop können die Teilnehmenden auch eigene Teekreationen herstellen und die Verpackung dazu individuell gestalten.
Film Saal
Film des Monats: Im Staub der Sterne
Eintritt frei
Science-Fiction, DDR 1976, 100 Min, Regie: Gottfried Kolditz
Filmvorführung
In der Reihe „Babelsberg statt Hollywood – 80 Jahre DEFA“
Eintritt frei
Auf der Erde wird ein Hilferuf vom Planeten TEM 4 empfangen. Die Kommandantin Akala landet mit ihrem Raumschiff Cynro auf TEM 4, aber von einer Notsituation keine Spur. Der Herrscher des Planeten gibt für seine Gäste ein rauschendes Fest, bei dem er ihr Bewusstsein manipuliert. Der an Bord gebliebene Navigator Suko bemerkt das und versucht nun, das Geheimnis des Planeten zu entschlüsseln. Er entdeckt ein Bergwerk, in dem die Turi, Ureinwohner des TEM 4, Sklavenarbeit verrichten müssen. Von ihnen stammte auch der Hilferuf. Die Kosmonauten stehen vor der Frage, wie sie den Turi helfen können, doch deren Unterdrücker wollen sie zum Abflug zwingen.
Gottfried Kolditz (1922–1982) war einer der produktivsten DEFA-Regisseure der 1960er und 1970er Jahre. Viele seiner Filme waren große Publikumserfolge in der DDR. Er studierte in Leipzig Germanistik, Schauspiel und Regie. Nachdem Kolditz einige Erfahrungen am Theater gesammelt hatte, ging er als Musikberater zur DEFA. Er drehte fortan in den verschiedensten Genres Filme wie etwa Märchen, Musicals, Komödien und Science-Fiction. Auch machte er sich einen Namen mit den sogenannten Indianerfilmen mit Gojko Mitic in der Hauptrolle.
Wissenschaftskino Saal
The Zone of Interest
Eintritt frei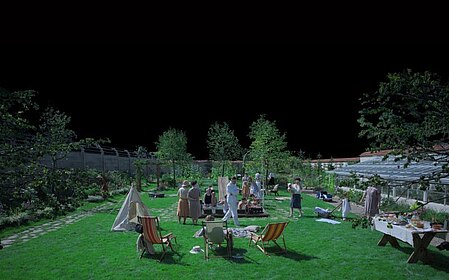
Spielfilm (USA/Vereinigtes Königreich/Polen 2023, 106 Min)
Regie: Jonathan Glazer
Filmvorführung und Gespräch
Mit Dr. Axel Doßmann (Historiker, Berlin)
Moderation: Dr. Julia Roos (Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow, Leipzig)
In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow und dem Referat Wissenspolitik der Stadt Leipzig
Eintritt frei
„The Zone of Interest“ von Regisseur Jonathan Glazer beleuchtet die Schrecken des Holocaust aus der Perspektive von Rudolf und Hedwig Höß. Der Kommandant von Auschwitz und seine Frau führten mit ihrer Familie in einem Bilderbuchheim – Mauer an Mauer mit dem Vernichtungslager – ein äußerst privilegiertes Leben. Rudolf Höß wird dargestellt von Christian Friedel. In der Rolle von Höß‘ Frau Hedwig brilliert die Leipziger Schauspielerin Sandra Hüller. Der Spielfilm erhielt bei der Oscarverleihung 2024 die Preise für den besten internationalen Film und den besten Ton.
Im Anschluss an die Filmvorführung ist das Publikum eingeladen, mit dem Historiker Dr. Axel Doßmann (Berlin) und Dr. Julia Roos (Leipzig) vom Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow über den historischen Kontext sowie die filmischen Darstellungsstrategien ins Gespräch zu kommen. Dr. Axel Doßmann lehrt und forscht zur Kultur- und Mediengeschichte des Nationalsozialismus und Kommunismus. Die Historikerin Dr. Julia Roos verantwortet die Wissenschaftskommunikation des Dubnow-Instituts.
Audioguide

Audioguide zur Dauerausstellung
Ob zu Hause, unterwegs oder im Museum: Unseren Audioguide zur Dauerausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum können Sie online jederzeit abrufen. Der Audioguide ist verfügbar in vier verschiedenen Sprachen, in Leichter Sprache, in Deutscher Gebärdensprache (DGS) und mit Audiodeskription.
Sie können sich auch für den Newsletter aus dem Haus der Geschichte und unseren Berliner Newsletter aus dem Tränenpalast und dem Museum in der Kulturbrauerei anmelden.


